
Tacrolimus wird vom Schimmelpilz Streptomyces tsukubaensis gebildet. Es ist mit den Macrolid-Antibiotika (z.B. Erythromycin) verwandt. Tacrolimus besitzt einen 23-gliederigen Lactonring. Tacrolimus ist lipophil, daher schlecht wasserlöslich.
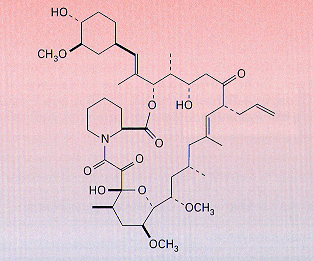
Die Wirkungsweise von Tacrolimus ist der des Ciclosporins ähnlich. Studien zeigen aber, dass Tacrolimus bei der Hemmung verschiedener Immunreaktionen 10 - 100 mal aktiver ist als Ciclosporin.
Die immunsuppressive Wirkung von Tacrolimus wird hauptsächlich durch die Hemmung der T-Zellaktivierung und-proliferation erreicht. Intrazellulär bindet es an ein Immunophilin, das FKBP-12-Protein. Der dabei entstehende Komplex hemmt die Enzymaktivität von Calcineurin. Dadurch wird die Dephosphorylierung und nukleäre Translokation der Transkriptionsfaktoren NF-AT verringert, welche die Transkription unterschiedlicher Zytokine wie IL-2, IL-4, TNF-α und Interferon-γ regulieren und so die Lymphozyten-Aktivierung und Proliferation einschränken. Gleichzeitig wird aber auch die Expression des profibrotischen TGF-beta stimuliert.
Nach Aufnahme wird Tacrolimus in hohem Masse an Proteine und Erythrozyten gebunden. Seine Bioverfügbarkeit von 6 - 56% ist vorwiegend von der Aktivität der Cytochrom P450 Isoenzyme CYP3A4 und CYP3A4 sowie die Effluxpumpe P-Glykoprotein (P-gp) abhängig.
Tacrolimus besitzt einen hohen Grad an Variabilität innerhalb und auch zwischen Patienten. Zu den Hauptbeeinträchtigungen gehören Nephrotoxizität, Neurotoxizität, gastrointestinale Beschwerden, Diabetes, Hypertonie and erhöhtes Tumorrisiko. |