
Biochemie
Struktur des freien Protoporphyrins:
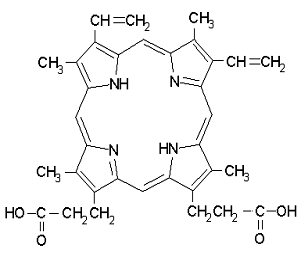
Protoporphyrin ist der unmittelbare Vorläufer des Häms (siehe Kopro- und Uroporphyrin quantitativ [Urin]). Protoporphyrin wird durch den Einbau eines Eisenions (Fe2+) in Häm umgewandelt. Diesen Schritt katalysiert die Ferrochelatase.
Die Hämsynthese findet vor allem in den Erythrozyten statt (für die Produktion von Hämoglobin), und in der Leber (für die Produktion von Cytochromen). Protoporphyrin ist schlecht wasserlöslich und deshalb im Urin nicht nachweisbar.
Erhöhte Konzentrationen an Protoporphyrin findet man bei einer Blockierung des Eiseneinbaus ins Häm:
- Die höchsten Werte (>10-mal obere Normgrenze) trifft man bei Patienten mit einer erythropoetischen Protoporphyrie. Bei dieser genetisch bedingten Krankheit ist die Aktivität der Ferrochelatase vermindert. Das Protoporphyrin liegt in der freien Form, das heisst ohne ein zentrales Metallion, vor.
- Mässig erhöhte Werte haben Patienten mit einer Bleivergiftung (Blei blockiert die Ferrochelatase) und Patienten mit einem Eisenmangel. In beiden Situationen wird anstelle des Eisens ein Zinkion (Zn2+) ins Protoporphyrin eingebaut: Zink-Protoporphyrin.
Zur Analytik: Bei der im IKCI verwendeten Extraktionsmethode von Piomelli (3) wird das Protoporphyrin mit einer Mischung von Essigsäure/Essigester aus EDTA-Blut extrahiert, mit Salzsäure rückextrahiert und im Fluorimeter gemessen. Bei der Extraktion mit Säure zerfallen die Zinkkomplexe, und alles Protoporphyrin wird in die freie Form überführt. Die Methode erlaubt also keine Rückschlüsse auf die Anteile von Zink-Protoporphyrin und freiem Protoporphyrin.
Klinik
Erythropoetische Protoporphyrie: akute Photodermatose, sehr schmerzhaft, auf belichtete Stellen beschränkt
Bleivergiftung: Anämie, Lähmungen, Abdominalkoliken | 
|