
Tacrolimus wird vom Schimmelpilz Streptomyces tsukubaensis gebildet. Es ist mit den Macrolid-Antibiotika (z.B. Erythromycin) verwandt. Tacrolimus besitzt einen 23-gliederigen Lactonring. Tacrolimus ist lipophil, daher schlecht wasserlöslich.
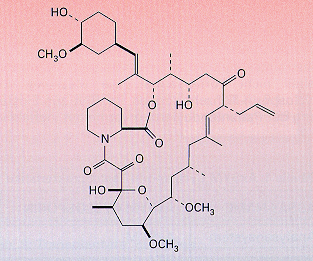
Die Wirkungsweise von Tacrolimus ist der des Ciclosporins ähnlich. Auch Tacrolimus unterbricht die Ereigniskette, welche zur Bildung zytotoxischer T-Lymphozyten führt, indem es die Bildung von IL-2 hemmt.
Tacrolimus bindet im Zytosol der T-Helferlymphozyten an ein als FKBP-12 bezeichnetes Protein. Dieser Komplex hemmt Calcineurin, welches für die Bildung von IL-2 und anderer Cytokine notwendig ist. Die Transplantatabstossung unterbleibt, weil sich ohne IL-2 die spezifischen zytotoxischen T-Lymphozyten nicht vermehren können. (3)
Bezogen auf das Gewicht, ist Tacrolimus rund zehnmal wirksamer als Ciclosporin. Die Nephrotoxizität ist etwas weniger ausgeprägt, als bei Ciclosporin.
Tacrolimus wird neuerdings mit Erfolg bei atopischem Ekzem und Neurodermitis auch topisch angewendet (Salbe).
Im Blut wird Tacrolimus grösstenteils (92-98%) von den Erythrozyten aufgenommen und intrazellulär an FKBP-12-Proteine gebunden; deshalb ist Vollblut als Probenmaterial zweckmässig. Die Fraktion im Plasma ist zum überwiegenden Teil an Albumin gebunden.
Tacrolimus wird zum grössten Teil durch das Isoenzym 3A4 des Zytochroms P450 metabolisiert, vor allem durch Hydroxylierung und Abspaltung von Methylgruppen. Bis heute sind 9 Metaboliten identifiziert worden. (1) Der Metabolit M-II (31-O-Demethyltacrolimus) hat laut Lit. (1) in vitro eine mit Tacrolimus vergleichbare immunsuppressive Wirkung; die anderen Metaboliten besitzen weniger als 10 % der Aktivität der Muttersubstanz.
Die gemessene Tacrolimus-Werte können bei Hypoalbuminämie oder bei tiefem Hämatokrit analytisch bedingt höher ausfallen, wenn ein immunologischer Test verwendet wird, im Vergleich zur HPLC-MS Diagnostik.(4) |