
Die Immunfixation ist eine Folgeuntersuchung zur Proteinelektrophorese. Sie erlaubt die Typisierung (Zuweisung zu einer Immunglobulinklasse) von monoklonalen Immunglobulinen oder freien Leichtketten, die bei der Proteinelektrophorese festgestellt werden. Bei den Immunglobulinen wird routinemässig auf IgA, IgG und IgM geprüft, nicht dagegen auf IgD und IgE. Bei den leichten Ketten werden Kappa und Lambda bestimmt.
Die Immunfixation ist eine rein qualitative Bestimmung. Quantitative Bestimmung der einzelnen Immunglobulinklassen und Immunfixation ergänzen einander.
Das Serum enthält normalerweise eine Mischung von Immunglobulin-Molekülen, die von zahlreichen verschiedenen B-Lymphozyten oder Plasmazellen stammen und sich in ihrer Klasse und in ihrer Antigenspezifität unterscheiden. Dieses polyklonale Immunglobulin erscheint in der Elektrophorese und in der Immunfixation als breite Bande.
Entartet dagegen ein B-Lymphozyt oder eine Plasmazelle zu einem malignen oder benignen Klon, so stellen alle seine Tochterzellen genau dasselbe Immunglobulin- Molekül her. In der Elektrophorese und in der Immunfixation zeigt sich ein solches monoklonales Immunglobulin als schmale, intensiv gefärbte Bande. Monoklonale Immunglobuline sind typisch für multiple Myelome und für M. Waldenström.
Die Immunfixation lässt sich auch im Urin durchführen, meist nach einer Aufkonzentrierung. Im Urin findet man vor allem freie Leichtketten. Je nach Serumkonzentration und Ausmass der Nierenschädigung sind manchmal auch Immunglobuline im Urin nachweisbar.
Einige Beispiele:
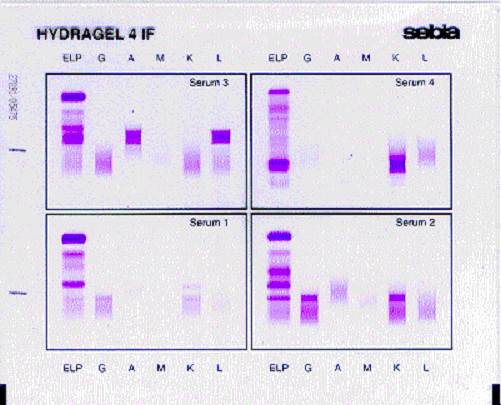
oben links: Serum, monoklonales IgA Typ Lambda, sowie polyklonales IgG mit Kappa- oder Lambda-Ketten
oben rechts: Urin, freie Leichtketten Typ Kappa
unten links: Urin, IgG Typ Kappa und Spur Leichtketten Typ Kappa
unten rechts: Serum, monoklonales IgG Typ Kappa sowie polyklonales IgG und IgA (gleicher Patient wie unten links) | 
|